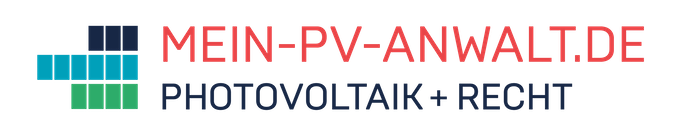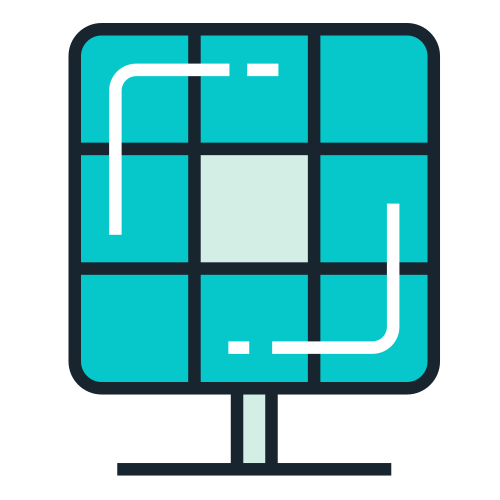Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verfolgt den Zweck, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu fördern. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, kann für den Strom, der mittels einer PV-Anlage erzeugt und in das allgemeine Stromnetz eingespeist wurde, Vergütung in der gesetzlichen Höhe beansprucht werden. Wie hoch diese Vergütung für eine bestimmte PV-Anlage ausfällt, ist jedoch nicht so einfach mit einem schnellen Blick ins Gesetz beantwortet.
Art der Förderung
Das EEG kennt für PV-Anlagen zwei verschiedene Arten der finanziellen Förderung: eine fixe Einspeisevergütung und die sogenannte Marktprämie (vgl. § 19 Abs. 1 EEG). Welche Form der finanziellen Förderung für eine konkrete PV-Anlage in Anspruch genommen werden kann, hängt von der Größe der betreffenden Anlage ab.
Einspeisevergütung
Bei der Einspeisevergütung erhält der Anlagebetreiber für jede in das Netz eingespeiste Kilowattstunde (kWh) eine fixe Vergütung. Die Einspeisevergütung gibt es gemäß § 21 EEG grundsätzlich nur noch für kleine PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 100 kWp.
Denn während das EEG früher grundsätzlich von einer fixen Einspeisevergütung ausging, wurde mit dem EEG 2012 der Grundsatz der Direktvermarktung eingeführt: Anlagenbetreiber sollen den von ihnen erzeugten Strom grundsätzlich selbst vermarkten bzw. von einem Direktvermarkter vermarkten lassen (vgl. § 2 Abs. 2 EEG). Die Geltendmachung einer (fixen) Einspeisevergütung stellt somit die Ausnahme vom Grundsatz der Direktvermarktung dar, die an besondere Voraussetzungen geknüpft ist.
Marktprämie
Für alle PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 kWp besteht dagegen die Pflicht zur Direktvermarktung. Der Anspruch gegenüber dem Netzbetreiber kann bei diesen Anlagen nur in Form der Marktprämie geltend gemacht werden. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der betreffenden PV-Anlagen ändert sich hierdurch jedoch – so jedenfalls die Theorie – nichts.
Bei der Marktprämie lässt der Anlagenbetreiber den von ihm erzeugten Strom in der Regel durch einen sogenannten Direktvermarkter vermarkten. Vom zuständigen Netzbetreiber kann der Anlagenbetreiber dann gemäß § 20 EEG (nur) noch die sogenannte Marktprämie verlangen. Die Marktprämieist im Wesentlichen die Differenz zwischen den Markterlösen, die der Anlagenbetreiber von seinem Direktvermarkter erhält, und der gesetzlich vorgesehenen Förderhöhe (die sogenannte Erlösobergrenze).
Dabei müssen allerdings zwei grundlegend verschiedene Formen der Marktprämie unterschieden werden:
- die Marktprämie für ausschreibungspflichtige Anlagen (vgl. § 22 Abs. 3 EEG) und
- die Marktprämie in gesetzlich bestimmter Höhe (vgl. §§ 48 und 49 EEG).
Höhe der gesetzlich bestimmten Förderung
Für Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 750 kWp ergibt sich die Höhe des Zahlungsanspruchs also in erster Linie aus dem Gesetz. Das EEG spricht insoweit von dem „anzulegenden Wert“, der mit der Strommenge zu multiplizieren ist. Bei den im Gesetz genannten „anzulegenden Werte“ handelt es sich jeweils um Netto-Beträge, sie beinhalten also noch nicht die Umsatzsteuer (vgl. § 23 Abs. 2 EEG).
Für PV-Anlagen ist vor allem § 48 EEG einschlägig. Demnach hängt der „anzulegende Wert“ im Wesentlichen von der Art, der Größe und der Lage der betreffenden PV-Anlage ab.
- In § 48 Abs. 1 EEG ist die sogenannte Grundvergütung geregelt. Diese Grundvergütung kann grundsätzlich für alle vergütungsfähigen PV-Anlagen geltend gemacht werden.
- Für Solaranlagen auf oder an einem Gebäude und für Solaranlagen an einer Lärmschutzwand kann unter bestimmten Voraussetzungen gemäß § 48 Abs. 2 EEG eine höhere Vergütung verlangt werden.
Die in § 48 EEG genannten anzulegenden Werte für PV-Anlagen mit einer installierten Leistung bis 750 kWp unterliegen allerdings der sogenannten Degression: Gemäß § 49 EEG ändert sich der tatsächliche anzulegende Wert regelmäßig in Abhängig davon, inwieweit der tatsächliche Zubau von PV-Anlagen im maßgeblichen Betrachtungszeitraum den gesetzlichen Zielkorridor überschritten oder unterschritten hat. Die in den einzelnen Monaten geltenden Fördersätze werden von der Bundesnetzagentur allgemein bestimmt und im regelmäßigen Turnus – alle drei Monate – veröffentlicht (abzurufen unter www.bundesnetzagentur.de).
Somit kommt es für die Förderhöhe einer bestimmten PV-Anlage auch auf eine zeitliche Komponente an. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der betreffenden PV-Anlage. Der Förderanspruch des Anlagenbetreibers berechnet sich also auf der Grundlage der von der Bundesnetzagentur für den betreffenden Monat der Inbetriebnahme veröffentlichten Werte. Daher sind aus der Perspektive der Anlagenbetreiber somit die von der Bundesnetzagentur veröffentlichten Werte (und nicht die in § 48 EEG genannten „anzulegenden Werte“) entscheidend.
Darüber hinaus folgt aus § 21 Abs. 1 Nr. 1 EEG in Verbindung mit § 53 Abs. 1 EEG, dass sich der anzulegende Wert bei PV-Anlagen mit weniger als 100 kWp installierter Leistung pauschal um 0,4 Ct/kWh reduziert. Der pauschale Abzug von 0,4 Ct/kWh wird damit begründet, dass der Aufwand des Anlagenbetreibers bei Erhalt einer fixen Einspeisevergütung geringer sei als bei der Direktvermarktung.
Förderdauer
Die gesetzliche Förderung wird grundsätzlich 20 Kalenderjahren ab Inbetriebnahmeder Anlage gewährt. Bei Anlagen, die nicht der Ausschreibungspflicht unterfallen, verlängert sich die Förderdauer bis zum 31. Dezember des letzten Förderjahres (vgl. § 25 EEG). Für alle PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 750 kW, die in 2019 in Betrieb genommen werden, endet die Förderung somit am 31.12.2039.

Rechtsanwalt Sebastian Lange ist Inhaber der in Potsdam ansässigen und bundesweit tätigen PROJEKTKANZLEI. Er hat sich wie kaum ein anderer Anwalt auf Photovoltaikanlagen spezialisiert und verfügt über langjährige Erfahrung in der juristischen Begleitung von PV-Projeken. Rechtsanwalt Lange ist zudem Vorsitzender der von ihm mitgegründeten Allianz Bauwerkintegrierte Photovoltaik e.V.